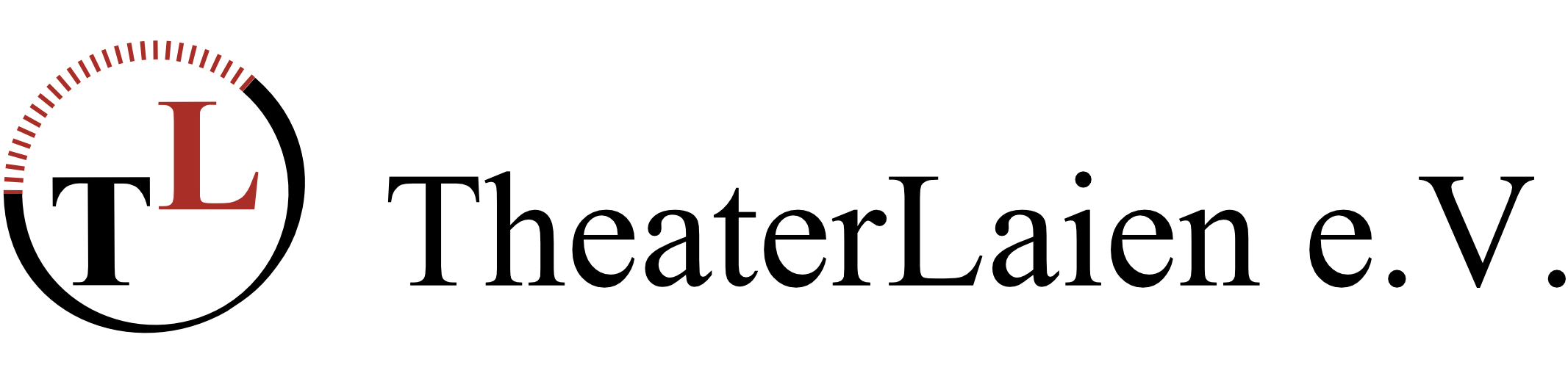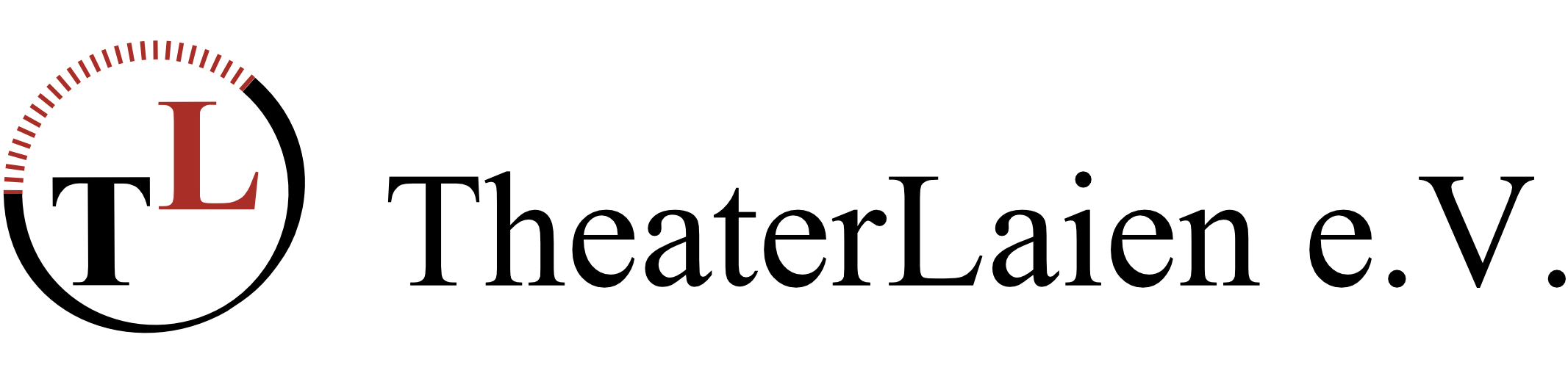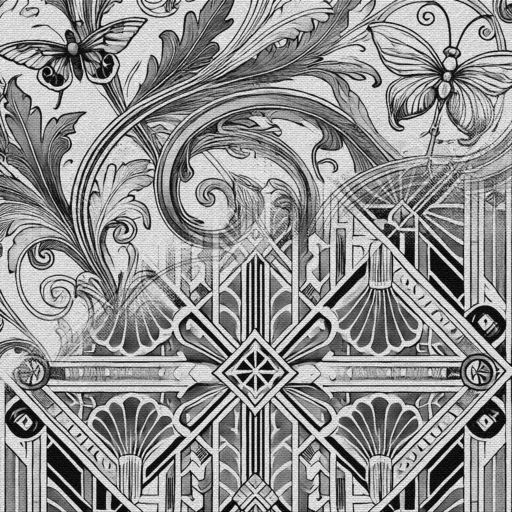
„Die Frauen von Mandsworth Hall“ von Susanne Fuß
Inszenierung: Kay Winter
Gesamtleitung: Jenny van der Horst
Inhalt
1921. Adelssitz im ländlichen England.
Der Krieg hat sowohl die Ständeordnung als auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft verändert. Die Töchter des Hausherrn, Lord Exeter, sind auf der Suche nach ihrer Identität und einer neuen Rolle als Frau.
Während die älteste lesbische Tochter Charlotte vergeblich versucht, den Heiratsplänen ihrer Eltern zu entgehen, sucht die jüngere Tochter ihre wahre große Liebe jenseits der Standesgrenzen. Das Dienstmädchen Clara ist derweil dem Charme eines Mannes erlegen, der für sie völlig außer Reichweite scheint.
Emotionale Szenen und pointierte Dialoge lassen die kontrastierenden Welten des Adels und der Dienerschaft wieder auferstehen, deren Grenzen sich mehr und mehr in Auflösung befinden und erinnern im Stil an das „Das Haus am Eaton Place“ und „Downton Abbey“.
Fotos
Besetzung
| Lady Anne (Annie), die jüngste Tochter | Katharina Soll |
| Lord Thomas Herrick | Frederick Opp |
| Clara Worthington, das neue Zimmermädchen | Ina Kohn |
| Lady Charlotte, die älteste Tochter | Mia Hilz |
| Lord Henry Exeter | Oliver Schürmann |
| Lady Linda Exeter | Birgit Hemmer |
| Mabel, Lady Charlottes Kammerzofe | Lena Michel |
| Lady Herrick | Kerstin Griese |
| Mrs Fry, Hausdame und Lady Lindas Kammerzofe | Susanne Sack |
| Hans Seidel, deutscher Kriegsgefangener | Florian Wittbold |
| Mr Holmes, Butler | Jörg Heikaus |
| Lady Marianne, Cousine von Charlotte und Annie | Jenny van der Horst |
| Lilli, Zimmermädchen | Marlene Boy |
| Mrs Roberts, Köchin | Tanja Follmann |
| Rachel, Küchenhilfe | Katharina Segatz |
| Elsie, Dienstmädchen | Ira Süssenbach |
| Evelyn, Stofflieferantin | Johanna Luisa Berg |
| Mary, Gärtnerin | Fenja Steffen |
Bühnenbau und Technik
Burkhard Angstmann
Frank Haferkamp
Gerd Sack
Jörg Heikaus
Tobias Blanke
Uwe Helling
Kostüme
Kerstin Griese
Marie Seemann
Autor
Susanne Fuß, Jahrgang 1968, aufgewachsen in Bonn, studierte Anglistik, Amerikanistik und Komparatistik. Nach diversen Jobs und Praktika im Theater arbeitete sie anschließend als Wissenschaftliche Dokumentarin im Deutschlandfunk, beim WDR und zuletzt beim Deutschen Musikrat. Neben der Literatur gilt ihre Liebe auch dem Film. Seit 2012 schreibt sie Drehbücher. Es reizt sie, Geschichten durch Bilder zu erzählen. Auch in ihrem ersten Roman spiegelt sich ihre Vorliebe für filmisches Erzählen. Ein guter Plot ist ihr mindestens ebenso wichtig, wie das Erschaffen unverwechselbarer Charaktere. Dabei fühlt sie sich auch literarisch dem Gebot des Altmeisters Billy Wilder verpflichtet, das da lautet: Du sollst nicht langweilen!
Quelle: https://www.amazon.de/stores/author/B00ZJLGSYC/about
Aus dem Programmheft
Dank der 1. Vorsitzenden
Nach den Aufführungen des sehr klassischen Stücks „Ein Sommernachtstraum“ präsentieren wir Ihnen nun mit Freude „Die Frauen von Mandsworth Hall“. Wie der Titel bereits verrät, stehen hier besonders die Frauen im Mittelpunkt der Handlung. Das Stück erzählt von der Selbstfindung der Frau nach dem Ersten Weltkrieg – ein interessantes Thema, das auch heute noch sehr aktuell ist. Die Reaktionen der Herrschaften und auch der Dienerschaft auf gleichgeschlechtliche Beziehungen könnten unterschiedlicher nicht sein und werden auf eindrucksvolle Weise emotional dargestellt.
Ich freue mich sehr, dass Kay Winter nach nunmehr ca. 20-jähriger Bühnenpräsenz endlich mit „Die Frauen von Mandsworth Hall“ das Regiedebüt feiert. Es ist großartig, Kay jetzt „auf der anderen Seite“ zu erleben – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Die Bühnengestaltung ist dieses Mal ungewohnt und spannend zugleich, denn auch der Raum neben der Hauptbühne wird von den Schauspielenden genutzt. Unser Bühnenbildteam hat alle Ideen der Regie wieder einmal wunderschön umgesetzt. Die Größe der Bühnen hat allerdings dazu geführt, dass wir keine Örtlichkeit gefunden haben, um eine dritte und vierte Aufführung „auswärts“ zu präsentieren.
Die Proben haben uns wieder großen Spaß gemacht. Durch die späten Ferien in diesem Jahr waren die Bedingungen allerdings etwas erschwert, da nach den Ferien keine zusätzliche Samstagsprobe für Bühnenaufbau und Durchlauf mehr möglich war. Auch die geschlossene Aula während der Ferienzeit stellt jedes Herbststück vor besondere Herausforderungen. Dennoch: selten waren wir schon so früh so gut vorbereitet.
Zum Schluss möchte ich allen Mitwirkenden von Herzen danken. Wie immer hat unser engagiertes TheaterLaien-Team hervorragend zusammengearbeitet.
Ihre Susanne Sack
Regie
Liebes Publikum,
für mich ist dieser Moment ein ganz besonderer und auch ein besonders aufregender. Nach über 20 Jahren auf der Bühne und einigen Jahren als Gesamtleitung, seht ihr heute Abend mit “Die Frauen von Mandsworth Hall” mein Regiedebüt.
Dass ich irgendwann auch mal im Regiestuhl Platz nehmen würde, ist in den letzten Jahren immer öfter Thema geworden und im vergangenen Jahr habe ich schließlich entschieden, das Ganze nicht mehr zu zergrübeln, sondern einfach zu machen. Ich weiß, dass ich mit unserem Vorstand Menschen im Rücken habe, auf die ich mich jederzeit verlassen kann. Danke euch dafür!
Ein Ensemble hatte sich schnell gefunden – offenbar fanden unsere Schauspieler:innen es gar nicht so abwegig, unter meiner Regie spielen zu wollen!
Die Wahl eines Theaterstücks stellte sich daraufhin allerdings als gar nicht so einfach dar: Wie auch der Rest der Welt ist auch das Theater historisch ein männlich dominiertes Feld und ein Stück zu finden, das nicht nur mit 14 Frauen und 4 Männern besetzbar ist, sondern auch noch, naja, interessant ist und thematisch zu dem passt, was ich gern inszenieren möchte, war eine ziemliche Herausforderung.
Aber wir haben ein Stück gefunden, das beinahe perfekt zur Besetzung passte und in das ich mich auch schnell verliebt habe. Auf dem Papier haben mir bereits die feministischen, queer-historischen und klassenkritischen Themen gefallen. Aber als meine Schauspieler:innen auf der Bühne diesen Szenen Leben eingehaucht haben, war ich häufig von Szene zu Szene hin- und hergerissen zwischen: “Awww, ist das schön!” und Kloß im Hals.
Das Thema Bühnenbild hat mir dann doch noch ein bisschen Sorgen bereitet. So hatte ich schon beim Lesen eine Vorstellung, wie sich die vielen Ortswechsel von Szene zu Szene umsetzen lassen würden, aber würden unsere Bühnenbildner – die schließlich die Expertise und Erfahrung haben – das auch so sehen? “Kein Problem, das machen wir doch ganz einfach so—,” war die Reaktion der Fachmenschen. Und wie ihr heute Abend seht, haben wir das Ganze auch “ganz einfach so” auf und neben die Bühne bekommen.
Ich hoffe, euch werden die Geschichten und Emotionen unserer Charaktere genauso mitnehmen, wie mich, und wünsche euch viel Vergnügen.
Kay A. Winter
Aristokratie und Emanzipation
Die 1920er Jahre waren eine Ära des globalen Wandels, geprägt von den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs. Auch die Aristokratie, traditionell eine der mächtigsten Gesellschaftsschichten, sah sich mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert. Sie stand unter erheblichem wirtschaftlichem Druck, da ihr klassischer Reichtum durch Landbesitz erodierte. Kriegsausgaben, höhere Einkommens- und Erbschaftssteuern sowie sinkende landwirtschaftliche Erträge schmälerten ihre Finanzen. Gleichzeitig fanden Dienstpersonal und Arbeitskräfte neue, besser bezahlte Jobs in den Städten und Fabriken, was es
dem Adel erschwerte, seine Anwesen zu unterhalten. Viele mussten ihre Betriebe verkleinern oder ganz aufgeben.
Besonders für Frauen lockerten sich die sozialen Regeln. Während des Krieges hatten sie viele Berufe der eingezogenen Männer übernommen. Obwohl viele nach Kriegsende in ihre traditionellen Rollen zurückkehrten, war ein neues Bewusstsein für weibliche Unabhängigkeit entfacht. Zudem hatten Frauen in vielen Ländern ab 1918 das Wahlrecht, was ihnen eine neue politische Stimme verlieh. Während in der breiten Gesellschaft offener über Ehe und Scheidung diskutiert wurde, blieben Skandale und Scheidungen in der Oberschicht weiterhin ein großes Tabuthema. Trotz des Verlusts ihrer politischen und wirtschaftlichen Vormachtstellung behielten Adelstitel und der damit verbundene soziale Status ihre große Bedeutung.
In Großbritannien etablierte sich in dieser Zeit der Begriff „Flapper“, der ursprünglich junge, unkonventionelle Mädchen beschrieb. Sie verkörperten einen neuen Kleidungsstil: bequemere, kürzere Kleider ohne Korsett, die einen androgynen Look bevorzugten. Sie trugen auffälliges Make-up und führten einen schnellen, leichtfertigen Lebensstil. Sie tanzten, rauchten, tranken Alkohol und fuhren Auto – alles Verhaltensweisen, die als provokativ galten. Auch bei aristokratischen Frauen waren diese Flapper-Tendenzen sichtbar. Diese Bewegung verschwand jedoch mit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre, hatte aber die ersten Grundsteine für das heutige Frauenbild und die Frauenrechte gelegt.
Ein weiteres Tabuthema waren lesbische Frauen. Obwohl es in England keine organisierten Lesben-Bewegungen gab, wurde weibliche Homosexualität im Gegensatz zur männlichen nicht strafrechtlich verfolgt. Dies ermöglichte die Entstehung von Treffpunkten für lesbische und bisexuelle Frauen, wo sie ohne Angst Beziehungen pflegen konnten. Ein männlicherer Kleidungsstil und bestimmte Erkennungsmerkmale dienten als Zeichen der Abkehr von der traditionellen Weiblichkeit und halfen ihnen, ihre Homosexualität zu signalisieren. Die gewonnene weibliche Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg schuf auch für homosexuelle Frauen Freiräume. Trotzdem herrschte in der Gesellschaft die Vorstellung, Homosexualität sei „krankhaft und unnatürlich“, was in den folgenden Jahrzehnten zu Verfolgung und Stigmatisierung führte.
Die 1920er Jahre legten trotz aller sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen entscheidende Grundsteine für die Emanzipation und Unabhängigkeit von Frauen – sei es im Adel, in der bürgerlichen
Gesellschaft oder in der lesbischen Subkultur.
Mia Hilz
Die Mode der Zwanzigerjahre
… ist nicht, was Sie gedacht haben! Anfang der Zwanzigerjahre, wurden die Röcke nur langsam kürzer, und die Taille saß noch relativ hoch. Selbst Ende der Zwanzigerjahre reichten die Kleider immer noch über die Knie. Neben dem Glockenhut gab es eine Menge an alternativen Hutformen, die ebenfalls als modisch angesehen wurden. On vogue waren Anleihen an asiatische, klassisch griechische oder ägyptische Muster und Formen.
Ziel der Mode war es, einen jungenhaften Körper zu kreieren. Die Unterwäsche sorgte für flache Brüste und Hüften. Zunächst schnitten sich nur wenige Frauen die Haare ab. Vielmehr stecken sie das lange Haar im Nacken zusammen, um den Anschein von kurzen Haaren zu erwecken.
Aber auch damals gab es modische und eher konservative Frauen. In unserem Stück sollen die Kostüme vor allem den jeweiligen Charakter unterstreichen. Gleichzeitig tragen sie der Situation Rechnung, dass ältere Menschen sich modisch häufig am Kleidungsstil ihrer Jugend orientieren. Man sieht den Unterschied zwischen Granny und ihren Enkelinnen deutlich. Annie als die jüngere der beiden Schwestern, trägt ihr Haar sogar noch offen. Beide Frauen unterscheiden sich in ihrer Kleidung jedoch stark von Marianne, die als erstes die Fesseln der englischen Aristokratie abgeworfen hat.
In den zwanziger Jahren wurden noch immer unterschiedliche Kleider für die jeweiligen Tätigkeiten getragen. Eine gut situierte Frau hatte ein Hauskleid, ein Tageskleid, ein Teekleid für semi-formelle Anlässe, ein Nachmittagskleid für formellere Aktivitäten und vielleicht noch ein Abendkleid. In unserem Stück unterscheiden wir nur zwischen Tages-und Abendkleidern.
Die Dienerschaft trägt entweder Uniformen oder bleibt im Konservatismus der Vorkriegszeit stecken. Auch ist ihre Kleidung nicht so farbenfroh, wie die Kleidung der Familie.
Kerstin Griese
Mrs. Robert’s köstliche Scones
Für den Teig:
- 250 g Mehl
- 1 EL Backpulver
- 1 EL Zucker
- 0,5 TL Salz
- 60 g kalte Butter
- 150 ml Vollmilch
- 1 Ei zum Bestreichen
Außerdem:
Mehl für die Arbeitsfläche
Den Backofen auf 190 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
Das Mehl mit Backpulver, Zucker und Salz mischen. Die kalte Butter in Stücken mit einem großen Löffel unter das Mehl rühren, bis die Konsistenz von krümeligem Sand entsteht. Das Mehlgemisch zurück in die
Schüssel geben und in der Mitte eine Mulde formen. Milch in die Mulde gießen und mit einer Gabel mit dem Vorteig vermengen, nicht kneten. Dadurch erhalten die Scones ihre typische Konsistenz.
Die Arbeitsfläche leicht bemehlen, den Teig darauf geben und ebenfalls mit Mehl bestäuben, damit beim Ausrollen nichts anklebt.
Den Teig 3 cm dick ausrollen. Mit einem Glas (6 cm) ca. 9 Scones aus dem Teig stechen.
Die Scones auf das Backblech setzen und mit einem verquirlten Eigelb (ggf. mit Milch vermischen) bestreichen. Im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene für 15 – 20 Minuten backen.
Die Scones kann man lauwarm mit Butter und Marmelade servieren. Typisch englisch wird es mit Clotted Cream.